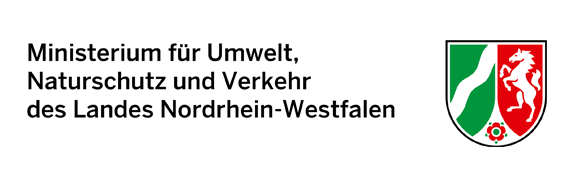Lebensräume
Besondere Arten benötigen besondere Lebensräume
Die Zielarten des Projektes sind auf spezielle Lebensräume angewiesen. Dazu gehören nicht nur natürliche Habitate, sondern auch viele Lebensräume, die durch menschliche Bewirtschaftung entstanden sind. Lebensräume wie Borstgrasrasen oder Bergmähwiesen benötigen auch heute noch eine Nutzung, die jedoch sehr extensiv sein muss. Im Waldbereich stellen insbesondere strukturreiche und alte Laubwälder wichtige Habitate dar.
6230 LRT Borstgrasrasen
| Kennarten: | Arten, die mit wenig Nährstoffen zurechtkommen, wie das namensgebende Borstgras (Nardus stricta), Arnika (Arnica montana), Gemeines Zittergras (Briza media), Harzer Labkraut (Galium saxatile) und Waldläusekraut (Pedicularis sylvatica). |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Borstgrasrasen sind in der Regel durch eine extensive Beweidung entstanden, wodurch über Jahrzehnte Nährstoffe aus dem Lebensraum entnommen worden sind. Daher ist auch die Beweidung die zielführende Bewirtschaftungsform. Jedoch kann auch durch eine extensive Mahd (ohne jegliche Düngung) die lebensraumtypische Artenzusammensetzung erhalten werden. |
| Gefährdung: | Dieser sehr magere Lebensraumtyp mit den daran angepassten Pflanzenarten ist vor allem durch einsetzenden Nährstoffeintrag, wie Gülle, Festmist oder Kalkung, stark gefährdet. Eine Intensivierung der Landnutzung, ob durch Überbeweidung oder Nährstoffeintrag, führt zu einer Veränderung der seltenen Artenzusammensetzung. |
| Besonderheiten: | Auf den mageren Borstgrasrasen wachsen verschiedene heimische Orchideenarten, wie das Gefleckte Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis) und die Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha). |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Borstgrasrasen machen rund 33 ha des Projektgebietes aus, was lediglich 0,7% der Gesamtfläche entspricht. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im FFH Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“. |
| Zielarten im Projektgebiet | Der Goldene Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) nutzt u.a. die Arnika als eine der wichtigsten Nektarpflanzen. Der Teufelsabbiss, in unserer Region die einzige Nahrungspflanze der Raupen, ist ebenfalls eine typische Art feuchter Borstgrasrasen. Das Braunkehlchen nutzt den Borstgrasrasen, mit den Strukturen aus |
| Maßnahmen im Projektgebiet: |
|



6430 LRT Feuchte Hochstaudenfluren
| Kennarten: | Typische Arten der Feuchten Hochstaudenfluren sind Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Trollblume (Trollius europaeus), Gemeine Blutweiderich (Lythrum salicaria), Sumpf-Scharfgarbe (Achillea ptarmica), Wiesen-Knöterich (Bistorta officinalis), Wasserdost (Eupatorium cannabinum) und der hoch giftige Blaue Eisenhut (Aconitum napellus). |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Eine gelegentliche Mahd (zwei- oder mehrjährig) verhindert eine zunehmende Sukzession und erhält die lebensraumtypischen Artenzusammensetzung. |
| Gefährdung: | Sowohl eine zu intensive Nutzung durch häufige Mahd oder Beweidung als auch eine Nutzungsaufgabe gefährden diesen Lebensraumtyp. Die Nutzungsaufgabe führt langfristig zu einer Verbuschung, wodurch die wertgebenden Arten verdrängt werden. Auch eine Veränderung des Wasserhaushaltes wirkt sich negativ auf die Hochstaudenfluren aus. |
| Besonderheiten: | Durch die vielfältige Artenzusammensetzung und den Blütenreichtum der Hochstaudenfluren können hier besonders in den Sommermonate zahlreiche Insektenarten beobachtet werden. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Im Projektgebiet kommen die Feuchten Hochstaudenfluren auf insgesamt 4 ha Fläche vor und sind eng mit den Glatthaferwiesen und Berg-Mähwiesen verzahnt. |
| Zielarten im Projektgebiet | Besonders das Braunkehlchen nutzt die hochwüchsigen vorjährigen Stauden als Ansitzwarten und die verdichtete Vegetation als Neststandort, zudem gibt es hier ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Bei ausreichendem Vorkommen des Wiesen-Knöterichs nutzt der Blauschillernde Feuerfalter die Flächen u. a. zur Eiablage. |



6510 LRT Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen
| Kennarten: | Es gibt trockene sowie feuchte Glatthaferwiesen, die sich in ihrem Arteninventar unterscheiden. Typische Kennarten sind u. a. der namensgebende Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Margerite (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) und Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea). Auf feuchteren Flächen findet sich der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) ein. |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Extensive Mahd oder Beweidung. Die erste Mahd sollte bestenfalls ab Mitte Juni erfolgen, so dass die Gräser zur Hauptblüte kommen können. Bei dem Vorkommen von Wiesenbrütern erst ab Mitte Juli. Eine zweite Mahd kann ab Ende August durchgeführt werden. Alternativ kann auch eine Nachbeweidung erfolgen. Je nach Ausprägung ist eine leichte Düngung (Erhaltungsdüngung) mit Festmist förderlich. |
| Gefährdung: | Eine Intensivierung der Grünlandnutzung, durch häufigere Mahd, erhöhten Nährstoffeintrag oder eine zu hohe Besatzdichte. Auch eine Nutzungsaufgabe und die damit einhergehende Verbuschung gefährden die Glatthaferwiesen. |
| Besonderheiten: | Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen zeichnen sich durch ein hohes Arteninventar aus, wodurch die Wiesen im Sommer bunt erblühen. Die große Pflanzenvielfalt lockt wiederum zahlreiche und z. T. seltene Insektenarten an. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Die Glatthaferwiesen umfassen insgesamt 66,4 ha im Projektgebiet und sind oftmals eng verzahnt mit den Lebensraumtypen „Feuchte Hochstaudenfluren“ und „Berg-Mähwiesen“. |
| Zielarten im Projektgebiet | Für das Braunkehlchen gehören die Glatthaferwiesen zu den wichtigsten Lebensraumtypen. Aber auch der Rotmilan nutzt besonders die frisch gemähten Wiesen zur Jagd. |



6520 LRT Berg-Mähwiesen
| Kennarten: | Typische Pflanzenarten der Berg-Mähwiesen sind u. a. Blutwurz (Potentilla errecta), Berwiesen-Frauenmantel (Alchemilla monticola), Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor), Wiesen-Knöterich (Bistorta officinalis), Trollblume (Trollius europaeus) und Gewöhnlicher Goldhafer (Trisetum flavescens). |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Extensive Mahd oder Beweidung. Die erste Mahd sollte bestenfalls ab Mitte Juni erfolgen, so dass die Gräser zur Hauptblüte kommen können. Bei dem Vorkommen von Wiesenbrütern erst ab Mitte Juli. Eine zweite Mahd kann ab Ende August durchgeführt werden. Alternativ kann auch eine Nachbeweidung erfolgen. Je nach Ausprägung ist eine leichte Düngung (Erhaltungsdüngung) mit Festmist förderlich. |
| Gefährdung: | Eine Intensivierung der Grünlandnutzung, durch häufigere Mahd, erhöhten Nährstoffeintrag oder eine zu hohe Besatzdichte. Auch eine Nutzungsaufgabe und die damit einhergehende Verbuschung gefährden die Berg-Mähwiesen. |
| Besonderheiten: | Wie der Name schon verrät, entwickeln sich Berg-Mähwiesen erst in höheren Lagen, etwa ab 400 m über NN. In tieferen Regionen werden sie durch die artenreichen Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen abgelöst. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Berg-Mähwiesen machen rund 58,5 ha der Gesamtfläche aus und gehen häufig in artenreiche Glatthaferwiesen und Feuchte Hochstaudenfluren über. |
| Zielarten im Projektgebiet | Für das Braunkehlchen gehören die Berg-Mähwiesen zu den wichtigsten Lebensraumtypen. Aber auch der Rotmilan nutzt besonders die frisch gemähten Wiesen zur Jagd. |


91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder
| Kennarten: | Auenwälder sind geprägt von Baumarten, die mit nassen Böden zurechtkommen, darunter Schwarz-Erle (Alnus glutinuosa), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Moorbirke (Betula pubescens) und Bruch-Weide (Salix fragilis). |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Auenwälder sollte bestenfalls sich selbst überlassen werden, so dass ausreichend Alt- und Totholz entsteht. Zusätzlich ist es förderlich nicht lebensraumtypische Baumarten zu entfernen und die natürliche Überflutungsdynamik dauerhaft zu gewährleisten. |
| Gefährdung: | Die Hauptgefährdungsursachen werden durch gewässerbauliche Veränderungen, insbesondere durch Uferverbau, Staustufenbau sowie die Begradigung des Gewässers, verursacht. Dadurch kommt es zu einer Veränderung der Überflutungsdynamik, was Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung der Auenwälder hat. Auch die Aufforstung mit nicht lebensraumtypischen Baumarten verändert diesen besonderen Lebensraumtyp nachhaltig. |
| Besonderheiten: | Auenwälder stellen einen wichtigen Hochwasserschutz entlang von Fließgewässern dar. Durch den natürlichen Überschwemmungsbereich kann sich der Fluss bei anhaltenden Niederschlägen ausbreiten, die Fließgeschwindigkeit wird aufgrund der Vegetation deutlich reduziert. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Dieser Lebensraumtyp kommt auf einer Fläche von rund 53 ha entlang von Quellbereichen und Bächen vor. Den größten Anteil umfassen die FFH-Gebiete „Weier- und Winterbachtal“ sowie „Rübgarten“. |
| Zielarten im Projektgebiet | Das Weichholzangebot nutzen vor allem die Spechtarten Mittelspecht (Dendrocoptes medius), Grauspecht (Picus canus) und Schwarzspecht (Dryocopus martius). Aber auch der Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle) profitiert von den strukturgebenden Auenwäldern. |



9110 LRT Hainsimsen-Buchenwald
| Kennarten: | Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse am Boden, haben Buchenwälder nur eine schwach ausgeprägte Krautschicht. Hier wachsen hauptsächlich die namensgebende Weiße Hainsimse (Luzula luzuloides) sowie Drahtschmiele und Heidelbeere. Unter die dominant vorkommende Rotbuche (Fagus sylvaticus), mischen sich gelegentlich auch Stiel- und Traubeneichen (Quercus robur, Quercus petraea) sowie Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus). |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Gewährleistung einer natürlichen Entwicklung mit ausreichend Alt- und Totholz als Lebensraum für verschiedene Vogel- und Fledermausarten. |
| Gefährdung: | Waldbauliche Maßnahmen, insbesondere Nadelholzaufforstung, zu hohe Wildbestände sowie zunehmende Trockenheit und Hitze. |
| Besonderheiten: | Ohne menschliche Nutzung würden bodensaure Buchenwälder den Großteil unserer natürlichen Vegetation ausmachen. Dadurch trägt Deutschland weltweit eine besondere Verantwortung für den Erhalt der Buchenwälder. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Der Hainsimsen-Buchenwald macht derzeit rund 124 ha Fläche im Gesamtgebiet aus. Das sind lediglich 3,7% der gesamten Waldflächen. |
| Zielarten im Projektgebiet | Hainsimsen-Buchenwälder sind geprägt von einem hohen Anteil an Alt- und Totholz, welches besonders von den Spechtarten Schwarzspecht (Dryocopus martius) und Grauspecht (Picus canus) genutzt wird. Der Rotmilan (Milvus milvus) nutzt den Wald zum Brüten. |



6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden
| Kennarten: | Die feuchten und nährstoffarmen Pfeifengraswiesen sind gekennzeichnet durch das Vorkommen von das Blaue Pfeifengras (Molinia caerulea). Weitere typische Arten sind u.a. Gewöhnlicher Teufelsabbiß (Succisa pratensis), Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis), Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Heilziest (Stachys officinalis) und Sumpf-Ständelwurz (Epipactis palustris). |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Dieser Lebensraum ist durch eine sehr extensive landwirtschaftliche Nutzung, d.h. wenige und späte Mahdtermine (sog. Streumahd) und keine Düngung entstanden. Das Pfeifengras ist zwar ein schlechtes Futtergras, aber ein gutes Streugras. |
| Gefährdung: | Pfeifengraswiesen sind sowohl durch eine Intensivierung der landwirtdchaftliche Nutzung, als auch durch Aufgabe der Nutzung gefährdet. Zum Erhalt dieses Lebensraumes sollten die Wiesen idealerweise nach traditioneller Art - einmal im Herbst - gemäht werden. |
| Besonderheiten: | Die besondere landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht es vielen Blütenpflanzen zur Blüte und Samenreife zu gelangen. Aufgrund des Blütenreichtums bieten Pfeifengraswiesen einen besonderen Lebensraum für seltene Tagfalterarten und gehören zu den artenreichsten Grünland-Lebensräumen in Deutschland. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Dieser Lebensraumtyp kommt in unser Ptojektgebiet auf einer Fläche von rund 8,8 ha in den FFH-Gebieten „Buchheller-Quellgebiet“ und „Bergwiesen Lippe“ vor. Der größte Anteil wird extensiv beweidet, da die sehr staunassen Flächen sehr schwer mit herkömmlichen Fahrzeugen befahren werden können. |
| Zielarten im Projektgebiet | Die Raupen des Blauschillerndes Feuerfalters (L. helle) und des Goldenen Scheckenfalters (E. aurinia) ernähren sich hauptsächlich jeweils von dem Schlangen-Knötterich und von dem Gewöhnlichen Teufelsabbiss. Auch für das Braunkelchen (Saxicola rubetra), den Rotmilan (Milvus milvus) und den Grauspecht (P. canus) sind Pfeifengraswiesen bedeutsame Lebensräume und wichtige Nahrungsquellen.
|
| Maßnahmen im Projektgebiet: |
|



9180 Schlucht- und Hangmischwälder
| Kennarten: | In Schluchten oder an Steilhängen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und mit grobem Untergrund aus Steinblöcken (Blockschutt) oder groben Schotter dominieren Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Esche (Fraxinus excelsior) die Baumschicht. Holunder (Sambucus racemosa, Sambucus nigra) können in der Strauchschicht auftreten. In der meist artenarmen Krautschicht sind säuretolerante Arten, wie Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) oder Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella) typisch. Weitere Arten können Wald-Schwingel (Festuca altissima) und Hain-Rispengras (Poa nemoralis) sein. Als Farngewächse passen Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) und Breitblättriger Dornfarn (Dryopteris dilatata) in diesen Biotoptyp. |
|---|---|
| Bewirtschaftung: | Durch Reduktion des Anteils an lebensraumtypfremden Gehölzen, Förderung lebensraumtypischer Gehölze, Entwicklung zum Dauerwald und Förderung von liegendem und stehendem Totholz kann dieser Lebensraum gefördert werden. |
| Gefährdung: | Wie alle Waldlebensräume, ist auch dieser Lebensraum durch intensive Forstwirtschaft oder einseitige Veränderungen des Baumbestandes gefährdet. Darüber hinaus können auch hohe Wildbestände den unterwuchs schädigen. |
| Besonderheiten: | In Hang- und Schluchtwäldern findet man typische Waldvögel, wie Schwarz-, Klein- und Grünspecht, Hohltaube, Trauerschnäpper, Schwarzstorch, Sumpfmeise und Waldschnepfe. Auch Amphibien und Insekten profitieren von diesem steinigen feuchten Lebensraum. |
| Vorkommen im Projektgebiet: | Dieser Lebensraumtyp kommt in unser Ptojektgebiet auf einer Fläche von rund 23,4 ha und verteilt sich auf die FFH-Gebiete „Rübgarten“ (5,8 ha), „Weier- und Winterbach“ (11,4 ha) und „Großer Stein mit umgebenden Buchwäldern“ H3,5 ha) auf. Im Projektgebiet stockt dieser Lebensraum kleinflächig an kühl-feuchten Standorten, mit ausgeprägter Krautschicht. |
| Zielarten im Projektgebiet | Besonders der Mittelspecht (Dendrocoptes medius) profitiert von diesem Lebensraumtyp, in dem die Altholz Bestände eine Insektenreiche Nahrungsquelle sichern und die Walstruktur auch Nistmöglichkeiten bietet. |
| Maßnahmen im Projektgebiet: |
|