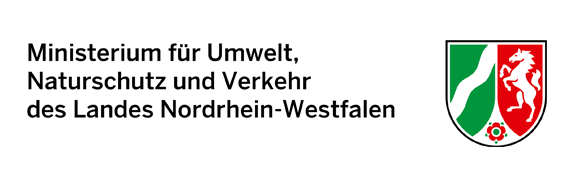Das haben wir schon erreicht:


Durchgeführten Maßnahmen im Überblick
Fichtenentnahme im FFH-Gebiet Buchhellerquellgebiet
Die Fichte wurde in der Vergangenheit im Siegerland auf vielen Waldstandorten angepflant, was dazu geführt hat, dass große Waldgebiete von Fichtenmonokulturen dominiert wurden. Stellenweise wurde die Fichte aber auch auf Grünlandflächen angepflanzt, sowie im Buchheller-Quellgebiet. Hier wurde ein Fichtengürtel auf Extensivgrünland gepflanzt, bei dem es sich überwiegend um Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen gehandelt hat. Der Fichtengürtel führte nicht nur zum Verlust von wertvollen FFH-Lebensräumen sondern blockierte auch den Austausch für Vogelarten wie das Braunkehlchen zum benachbarten Vogelschutzgebiet in Rheinland‑Pfalz. Ziel der Maßnahme ist daher die ehemaligen Offenlandlebensräume wiederherzustellen und auf 35 Hektar ein Biotopverbundsystem zu schaffen, welches mit benachbarten, außerhalb der Projektkulisse liegenden Gebieten (wie dem VSG Westerwald) in Verbindung steht.
Als erster Schritt zur Wiederherstellung ehemaliger Grünlandflächen im FFH-Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“ wurden im Mai 2022 auf einer Fläche von rund 35 Hektar die standortsfremden Fichten entnommen.
Die Maßnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Burbach und dem Forstzweckverband Burbach. Die Fichten wurden mittels eines Holzvollernters entnommen und mit einem Rückezug bis zum festgelegten Ablageort abtransportiert.

Entfernung von Fichtenbeständen

Transport der geernteten Fichtenstämme mit einem Rückezug
Mulcharbeiten und Wiedervernässung der Flächen
Im Februar 2023 begann die eigentliche Umwandlung der Flächen zu artenreichem Grünland. Nachdem im Vorjahr die Fichten geerntet worden waren, starteten die Mulcharbeiten zunächst auf einer rund 6 Hektar großen Fläche.
Im Juli 2023 folgte die Bearbeitung einer weiteren, etwa 10 Hektar großen Fläche. Die Vorbereitung dieser Maßnahme begann bereits einen Monat zuvor: Zum einen wurden weitere Fichten entfernt, die teils in den Randbereichen der Fläche sowie innerhalb eines angrenzenden Laubholzbestands verblieben waren. Parallel dazu wurden die Flächen vor den Mulcharbeiten nach Amphibien, Reptilien oder anderen Tieren abgesucht. Gefundene Tiere wurden innerhalb des Gebietes umgesetzt.
Zusätzlich wurde ein etwa 25 Meter langer und 5 Meter breiter Streifen entbuscht, um eine Verbindung zur benachbarten Weidefläche herzustellen.
Durch die frühere Fichtennutzung wurden auch Reste des alten Entwässerungssystems sichtbar. Im Zuge der Mulcharbeiten konnten mithilfe eines Baggers mehrere Gräben verschlossen und Teilbereiche der Fläche gezielt wiedervernässt werden. Zudem wurde ein angrenzender Erlenbruchwald als natürlicher Vorfluter im ehemaligen Bachbett der Buchheller reaktiviert.
Auf beiden Flächen erfolgten die Räumung und Bodenbearbeitung durch ein koordiniertes Team aus Mulcher, Bagger und Muldenkipper. Dabei wurden verbliebene Holzreste, insbesondere Baumstümpfe, zerkleinert und mit der obersten Bodenschicht vermengt. Dieses Verfahren erleichtert die spätere Bearbeitung und schafft die Grundlage für eine langfristige Nutzung der Fläche als Grünland.

Mulcharbeiten auf der großen Fläche im Buchheller-Quellgebiet

Entbuschungsmaßnahmen im Buchheller-Quellgebiet

Schließung der Gräben zur Wiedervernässung der Flächen
Mahdgutübertragung
Ebenfalls im Juli 2023 erfolgte auf einer 6 Hektar großen Fläche eine Mahdgutübertragung. Dabei wurde das Mahdgut mithilfe eines Miststreuers gleichmäßig auf der zuvor gemulchten Fläche verteilt. Das Material stammte von artenreichen Mähwiesen der näheren Umgebung, die sich überwiegend durch die ursprünglich im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen auszeichneten. Durch die Verwendung von lokalem Mahdgut wird zum einen die Biodiversität gefördert, zum anderen erhöht die kurze Distanz zwischen Entnahme- und Ausbringungsflächen die Wahrscheinlichkeit, dass möglichst viele keimfähige Samen im Material erhalten bleiben.
Im September 2023 wurde eine weitere Mahdgutübertragung auf einer 10 Hektar großen Fläche durchgeführt. Ein Teil des Mahdguts stammte aus feuchten Borstgrasrasen (FFH-Lebensraumtyp 6230). Bei der Auswahl der Spenderflächen wurde darauf geachtet, dass sie sich in unmittelbarer Nähe und im gleichen Naturraum (Hoher Westerwald) befinden. Mit freundlicher Unterstützung aus Rheinland-Pfalz konnte Mahdgut aus dem NSG Fuchskaute und dem NSG Wacholderheide in Westernohe ins Buchheller-Quellgebiet gebracht werden. Die Ausbringung erfolgte an zwei Terminen mithilfe von Miststreuern. Besonderes Augenmerk wurde auf spätblühende Arten wie den Gewöhnlichen Teufelsabbiss (Succisa pratensis) gelegt, die für die Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters (Euphydryas aurinia) von großer Bedeutung sind. Zusätzlich wurden Einzelpflanzen des Teufelsabbiss gezielt auf den wiederhergestellten Grünlandflächen angepflanzt. Abschließend wurde zusätzlich handverlesenes Saatgut von Pfeifengraswiesen des Buchheller-Quellgebiets auf geeigneten feuchten Teilflächen verteilt. Auch dieses enthielt Samen des Gewöhnlichen Teufelsabbiss, um die Lebensräume gezielt auf die Rückkehr des Goldenen Scheckenfalters vorzubereiten.
Die Mahdgutübertragung beschreibt grundsätzlich das gezielte Ausbringen von Pflanzenmaterial, das bei der Mahd artenreicher Spenderflächen anfällt. Dieses Heu wird geschwadet, lose verladen und auf Ziel- bzw. Empfängerflächen verteilt. Das enthaltene Saatgut stammt direkt von der Spenderfläche und soll auf der neuen Fläche keimen und sich etablieren. Diese Methode stellt eine sinnvolle und wichtige Maßnahme im Naturschutz dar: Sie dient dem Erhalt der Artenvielfalt, fördert seltene Pflanzenarten und schafft neue Lebensräume.

Mahdgutübertragung auf einer 6 Hektar großen Fläche

Miststreuer verteilt artenreiches Mahdgut im Buchheller-Quellgebiet
Zaunbau und Beweidung
Im März 2024 wurden die Flächen als Vorbereitung auf die geplante Beweidung eingezäunt. Auf rund 16 Hektar wurden stabile, für die Region typische Weidezäune angebracht.
Im Sommer 2024 begann die extensive Beweidung der wiederhergestellten Grünlandflächen, unter anderem durch das Rote Höhenvieh, eine robuste und landschaftspflegende Nutztierrasse.
Zum 1. Januar 2025 wurden die Flächen offiziell in den Vertragsnaturschutz aufgenommen.

Holzpfähle werden für den Zaunbau in den Boden eingeschlagen.

Rote Höhenvieh