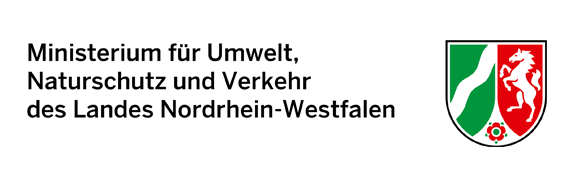Durchgeführten Maßnahmen im Überblick
Entbuschung
Im Frühjahr 2023 begannen auf einer Gesamtfläche von fast 4 Hektar erste Entbuschungsmaßnahmen in den FFH-Gebieten „Hickengrund/Wetterbachtal“ bei Burbach-Holzhausen und im „Buchheller Quellgebiet“ bei Burbach-Lippe. Ziel war es, Gehölze und aufkommende Bäume zurückzudrängen, um das Offenland zu erhalten und die Lebensbedingungen für wertvolle Arten zu verbessern. Verbuschungen im Offenland führen somit zum Verlust von wertgebenden Lebensräume die nur durch Entbuschung erhalten bzw. wiederhergestellt werden können.
Im Winter 2024 wurden die Entbuschungsmaßnahmen im Buchheller-Quellgebiet auf weiteren 6 Hektar fortgesetzt. Mithilfe eines Schreitbaggers konnten dort offene Lebensräume wie Pfeifengraswiesen, Borstgrasrasen und Hochstaudenfluren gesichert und gezielt gefördert werden.
Die geschützten FFH-Lebensraumtypen dieser Gebiete sind durch menschliche Nutzung, insbesondere Mahd und Beweidung, entstanden und konnten bis heute erhalten bleiben. Ihre ökologische Bedeutung ist groß: Sie bieten wertvollen Lebensraum für zahlreiche Arten, darunter unsere beiden Projektzielarten, das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) und den Blauschillernden Feuerfalter (Lycaena helle). Aber auch viele weitere Vogel- und Insektenarten profitieren von diesen artenreichen, extensiv genutzten Grünlandflächen.

Vor der Entschuschung

Nach der Entbuschung
Bekämpfung von Problempflanzen: Jakobs-Kreuzkraut
Rupfaktionen
Im Juli 2022 fand der erste Aktionstag zur Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts (Jacobaea vulgaris) mit Mitgliedern des TuS Lippe statt. Gemeinsam befreiten 27 Teilnehmende rund 2,7 Hektar artenreiche Bergmähwiesen von der problematischen Pflanze. Das gewonnene Heu ist nun wieder bedenkenlos nutzbar.
Zwar handelt es sich beim Jakobs-Kreuzkraut um eine heimische Art, jedoch hat sie sich in den letzten Jahren stark ausgebreitet. Problematisch ist, dass die Pflanze im getrockneten Zustand ihre Bitterstoffe verliert und von Weidetieren nicht mehr gemieden, sondern gefressen wird. Eine übermäßige Ausbreitung dieser Giftpflanze auf Wiesen macht das Heu unbrauchbar, ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden für die Landwirt*innen. Doch auch für den Naturschutz birgt das Probleme: Wenn Flächen aufgrund des massenhaften Auftretens von Jakobs-Kreuzkraut nicht mehr bewirtschaftet werden, droht der Verlust wertvoller Lebensräume. Daher ist hier eine Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft gefragt.
Ebenfalls im Juli 2022 fand eine weitere Rupfaktion in Burbach-Oberdresselndorf statt. Dort wurde das Jakobs-Kreuzkraut auf insgesamt 48 Hektar Bergmähwiese rechtzeitig vor der Mahd entfernt.
Am 1. Juli 2023 folgte eine groß angelegte Rupfaktion in den Gemeinden Netphen, Burbach (insbesondere Burbach-Lippe) und Freudenberg. Insgesamt engagierten sich 52 freiwillige HelferInnen, LandbewirtschafterInnen und Mitarbeitende der Biologischen Station, um die Giftpflanze auf Wiesen und Weiden zu entfernen.
Die Maßnahmen aus dem Jahr 2022 zeigten bereits Wirkung: Auf den damals bearbeiteten Flächen wurde ein deutlicher Rückgang des Jakobs-Kreuzkrauts festgestellt. Insgesamt wurden bei der Aktion im Juli 2023 rund 71,5 Hektar Fläche in den drei Gemeinden bearbeitet.
Auch im Jahr 2025 wurde erneut eine Rupfaktion durchgeführt, auf rund 50 Hektar Fläche wurde das Jakobskreuzkraut gezielt entfernt. Seit der ersten Maßnahme im Jahr 2022 lässt sich in Burbach-Lippe ein deutlicher Rückgang des Jakobskreuzkrautes beobachten: Aktuell liegt er nur noch bei etwa einem Drittel bis einem Viertel des ursprünglichen Bestandes von vor drei Jahren.
Test einer Belüftungswalze
In Kooperation mit der Universität Bochum wurde im Projekt eine Bachelorarbeit zur mechanischen Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts durchgeführt.
Unter dem Titel „Einsatz einer Belüftungswalze zur Reduzierung des Jakobs-Greiskrauts* in einer Wiesengesellschaft“ reichte Linnea Marie Geurtz ihre Arbeit am 08.08.2023 ein.
Untersucht wurde die Wirkung einer Belüftungswalze auf Nährstoffverfügbarkeit, Vegetationsstruktur und das Vorkommen von Jakobs-Kreuzkraut. Zwar zeigte sich ein Anstieg der mineralisierten Stickstoffwerte (Nmin), jedoch keine Verdichtung der Vegetationsnarbe. Die Anzahl der Jakobs-Kreuzkraut-Pflanzen war auf den behandelten Flächen sogar höher als auf den Kontrollflächen.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Methode im ersten Jahr nicht zur Zurückdrängung, sondern möglicherweise zur Förderung des Jakobs-Kreuzkraut führt.
*Das Jakobs-Kreuzkraut wird auch Jakobs-Greiskraut genannt.

Freiwilligen HelferInnen bei der Rupfaktion

Engagierte Freiwillige im Einsatz

Jakobs-Kreuzkraut (Jacobaea vulgaris)

Einsatz einer Belüftungswalze zur Bekämpfung des Jakobs-Greiskrauts

Belüftungswalze
Bekämpfung von Neophyten: Vielblättrige Lupine
Seit Mai 2024 wird im Projektgebiet gezielt die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) bekämpft. Die aus Nordamerika stammende invasive Art gefährdet durch ihre rasche Ausbreitung und die mit ihr einhergehende Stickstoffanreicherung insbesondere magere, artenreiche Lebensräume wie Borstgrasrasen, Berg- und Pfeifengraswiesen. Diese sind auf nährstoffarme Bedingungen angewiesen und beherbergen zahlreiche gefährdete Pflanzenarten.
Im Buchheller-Quellgebiet wurde die Vielblättrige Lupine bereits im Jahr 2024 nachgewiesen und stellt dort eine direkte Bedrohung für eben diese wertvollen Lebensräume dar. Um deren Erhalt langfristig zu sichern, wurde die Pflanze seitdem in mehreren gezielten Durchgängen samt Wurzelmaterial vollständig entfernt.

Blütenstand der Vielblättrige Lupine

Vielblättrige Lupine
Förderung Falter-Nahrungspflanzen
Im Oktober 2023 wurden im Buchhellerquellgebiet gezielt Maßnahmen zur Förderung des Goldenen Scheckenfalters (Euphydryas aurinia) umgesetzt. Als Raupennahrungspflanze wurden rund 1000 Exemplare des Teufelsabbiss (Succisa pratensis) in 100 Pflanzpatches an ehemaligen Flugstellen und geeigneten Habitaten zur Wiederansiedlung eingebracht. Die verwendeten Pflanzen stammen aus einer Wildsamenkollektion, die 2022 in den der Naturschutzgebieten Buchheller-Quellgebiet und Mückewies gewonnen wurde. Zwei spezialisierte Staudengärtnereien zogen die Pflanzen in torffreiem Substrat vor. Gepflanzt wurde per Hand mithilfe von Pflanzspaten in Patches von je 1 m², bestehend aus 9 bis 11 Einzelpflanzen.
Für die Habitataufwertung wurde auch mit Kollegen aus Rheinland-Pfalz zusammengearbeitet. Im NSG Fuchskaute im Westerwaldkreis, wo eine der letzten bekannten Populationen des Goldenen Scheckenfalters in der Region vorkommt, wurde ein weiterer Habitat-Patch mit einer Fläche von etwa 35 m² angelegt. Auch hier stammten die Pflanzen von spezialisierten Staudengärtnereien und wurden mit einer Dichte von 9–11 Pflanzen pro Quadratmeter gepflanzt.
Im Oktober 2024 wurden im NSG Fuchskaute zwei weitere sogenannte ‚Habitat-Patches‘ angelegt. Wiederum wurden Pflanzen aus regionaler Wildsamenherkunft verwendet, vorgezogen in der Wittgensteiner Staudengärtnerei. Zwei Flächen von ca. 60 m² und 40 m² wurden mit insgesamt 1000 Jungpflanzen in gleicher Dichte (9–11 Pflanzen/m²) bepflanzt, ein weiterer Schritt zur Wiederherstellung eines funktionsfähigen Lebensraums für diese streng geschützte Schmetterlingsart.

Zweiter Habitat-Patch im NSG Fuchkaute

Pflanzpatch im Buchheller-Quellgebiet
Förderung sektoraler Wechselbrachen und Aufstellung von Sitzwarten
Wechselbrachen
Im Mai 2024 wurden im Buchheller-Quellgebiet auf Weiden und Mahdflächen rund vier Hektar als Wechselbrachen eingerichtet. Die Abgrenzung erfolgte auf den Weiden mit mobilen Zäunen, auf den Mähwiesen durch das Abstecken bestimmter Bereiche. Diese Flächen blieben in diesem Jahr ungemäht, um Lebensräume für Bodenbrüter zu schaffen und die Vielfalt der Insekten zu fördern. Zugleich leisten die Wechselbrachen einen wichtigen Beitrag zur geplanten Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters. Denn auf diesen Flächen wurde der Gewöhnliche Teufelsabbiss (Succisa pratensis) gepflanzt, die Raupennahrungspflanze dieser seltenen Schmetterlingsart.
Auch im Mai 2025 wurden weitere 4,7 Hektar als Wechselbrachen ausgewiesen. Ziel ist es, der Verbuschung entgegenzuwirken und zu verhindern, dass die wertvollen Offenlandbereiche der natürlichen Sukzession überlassen werden.
Sitzwarten
Ebenfalls im Mai 2025 wurden im FFH-Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“ 20 Bambusstangen als Sitzwarten für unsere Wiesenvögel aufgestellt. Von diesen erhöhten Aussichtspunkten aus können sie singen, um ihr Revier zu markieren, und nach Insekten jagen. Insbesondere möchten wir unsere Zielart, das Braunkehlchen, fördern, das Mitte April aus Westafrika in unserem Vogelschutzgebiet zurückgekehrt.

Wechselbrache

Sitzwarte
Etablierung ökologischer Mahdtechnik
Wiesen müssen regelmäßig gemäht werden, um ihre ökologische Funktion zu erhalten. Herkömmliche Mähtechniken, insbesondere mit rotierenden Mähwerken, stellen jedoch ein erhebliches Risiko für Insekten dar: Viele Tiere werden getötet, und nach der Mahd fehlen ihnen Futterpflanzen.
Dennoch lassen sich Wiesen insektenfreundlich bewirtschaften. Besonders geeignet sind Messerbalkenmähwerke (Fingerbalken- oder Doppelmessertechnik), die mit einem horizontalen Schneidewerk und langsamer Fahrgeschwindigkeit arbeiten. Dadurch wird das Ansaugen von Insekten vermieden, wie es bei Kreiselmähwerken häufig der Fall ist. Zusätzlichen Schutz bieten sogenannte Insektenscheuchen, die Tiere zur Flucht anregen, bevor das Mähwerk eintrifft. Diese können unabhängig vom eingesetzten Mähwerk verwendet werden.
Zur Förderung insektenschonender Bewirtschaftung im Projektgebiet sollen zwei Messerbalkenmähwerke angeschafft und Landbewirtschaftern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, den Wechsel von konventionellen zu naturschonenden Mahdtechniken aktiv zu unterstützen.
Am 16. Juli 2024 demonstrierte die Firma Kersten Maschinenfabrik im Rahmen des LIFE-Projekts in Burbach-Lippe den praktischen Einsatz von Doppelmesser-Balkenmähwerken.
Die Anwendung ökologischer Mahdtechniken wird zusätzlich im Rahmen des Vertragsnaturschutzes durch die Landwirtschaftskammer gefördert. Im Vogelschutzgebiet kommen solche Verfahren bereits teilweise zur Anwendung.

Doppelmesser-Balkenmähwerk
Erwerb eines Wiesensamensammlers zur Samengewinnung für Ergänzungseinsaaten
Dank der Unterstützung durch FöNa Fördermitteln (Förderrichtlinie Naturschutz) konnten wir im Rahmen des Projekts einen Wiesensamensammler anschaffen. Im Juni 2024 wurden erste Feldversuche mit dem Gerät erfolgreich durchgeführt. Der Wiesensamensammler bürstet die Samen direkt aus den Gräsern und Kräutern aus, ganz ohne Mähen oder Dreschen. Das gewonnene Saatgut wird gezielt geerntet und für die Ergänzungseinsaat auf Umwandlungsflächen oder verarmten Wiesen genutzt, um wertvolle Pflanzenbestände zu fördern und die Artenvielfalt zu erhöhen.

Wiesensamensammler
Broschüre: Insektenreiches Grünland
In dieser Broschüre haben wir alle wichtigen Informationen zusammengestellt, damit Naturschutz und Landwirtschaft Hand in Hand artenreiche Ökosysteme im Offenland fördern können.

Flyer Insektenreiches Grünland